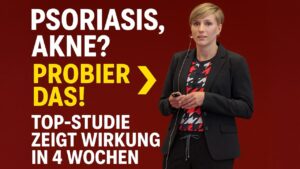KURZÜBERSICHT
Wundarten im Blick
-
Akut: plötzlich, unkompliziert, meist rasche Heilung (z. B. Schürf-/Schnitt- oder OP-Wunden).
-
Chronisch: bleibt über Wochen offen – oft wegen Durchblutung, Druck, Diabetes oder Infektion.
Drei Phasen, ein Ziel
-
Exsudation: Blutstillung, Reinigung, Entzündungsantwort.
-
Granulation: neues Gewebe, feine Blutgefäße, Wunde wird kleiner.
-
Epithelisierung: Haut schließt, Kollagen reift, Narbe stabilisiert sich.
Das hilft im Alltag
-
Sanft reinigen, feucht abdecken, Reibung vermeiden, eiweiß- & vitaminreich essen, ausreichend trinken – und Warnzeichen ernst nehmen.
Phasen der Wundheilung verstehen

Ob aufgeschürftes Knie nach dem Sport oder Schnitt an der Küchenarbeitsplatte: Die meisten akuten Verletzungen schließen sich schnell von selbst. Bleibt eine Wunde jedoch hartnäckig offen, verunsichert das – vor allem, wenn Schmerzen, unangenehmer Geruch oder wiederkehrende Krusten hinzukommen. Hier hilft es, die Phasen der Wundheilung zu kennen. Denn Ihr Körper durchläuft bei jeder Verletzung einen geordneten Prozess aus Reinigen, Auffüllen und Schließen. Wer diesen Ablauf versteht, kann die eigene Wundpflege besser planen, typische Fehler vermeiden und rechtzeitig Warnzeichen erkennen. Dieser Beitrag bietet Orientierung (keine Behandlung) für Betroffene, Angehörige und Pflegekräfte – mit praktischen Beispielen, verständlicher Sprache und klaren Handlungsschritten.
–
Akute und chronische Wunden – was unterscheidet sie?
Akute Wunden entstehen durch äußere Einwirkung auf zuvor gesunde Haut: Schnitt- oder Schürfwunden im Alltag, kleine Verbrennungen, Platzwunden nach Sturz, Operationsschnitte. Bei unkompliziertem Verlauf und guter Versorgung heilen sie primär: Die Ränder finden wieder zusammen (teils mit Naht/Klammer), Entzündungszeichen klingen ab, neues Gewebe bildet sich, die Haut schließt zügig.
Chronische Wunden bleiben trotz korrekter Pflege über Wochen offen. In der Praxis spricht man davon, wenn innerhalb von etwa 8–12 Wochen keine überzeugende Heilungstendenz zu sehen ist. Meist bremsen Grunderkrankungen oder Umstände den Prozess: venöse oder arterielle Durchblutungsstörungen (Ulcus cruris), Diabetes mellitus (diabetischer Fuß), Druck/Scherkräfte (Dekubitus), wiederkehrende Infektionen, Nährstoffmangel, Rauchen oder unpassende Produkte. Solche Wunden heilen sekundär: Von unten nach oben wächst Ersatzgewebe, die Ränder ziehen später nach. Das braucht Geduld, konsequente Versorgung – und die Behandlung der Ursache (z. B. Kompression, Druckentlastung, Blutzuckerstabilisierung).
–
Phase 1: Exsudation (Entzündungs- und Reinigungsphase)
Start unmittelbar nach der Verletzung. Blut tritt aus, spült Schmutz und Keime; die Gerinnung bildet einen vorläufigen Verschluss. Blutgefäße werden durchlässiger, Abwehrzellen erreichen die Wunde, Wundflüssigkeit (Exsudat) transportiert Zelltrümmer nach außen. Von außen typisch: Rötung, Wärme, Schwellung, pochender Schmerz, eventuell klare bis gelbliche Flüssigkeit.
So unterstützen Sie sinnvoll:
-
Hände gründlich reinigen (vor/nach der Versorgung).
-
Sanft spülen: lauwarmes Leitungswasser (Trinkqualität) oder sterile Kochsalzlösung. Kleine Partikel (z. B. Asphaltkörnchen) vorsichtig entfernen.
-
Gezielte Antiseptik: Bei Infektionsgefahr (Biss-/Stichwunde, stark verschmutzt) einmalig ein geeignetes Wundantiseptikum dünn auftragen. Hochprozentigen Alkohol, Jodtinkturen oder „brennende“ Hausmittel vermeiden – sie schädigen gesundes Gewebe.
-
Passend abdecken: Atraumatisches Pflaster/Verband, das die Wunde feucht hält, vor Reibung schützt und nicht verklebt.
-
Ruhe & Schutz: Reibung, Druck, Zug vermeiden; Wunde ggf. hochlagern.
Wichtig: In der Exsudationsphase steht Säubern und Beruhigen im Vordergrund. Der Aufbau von neuem Gewebe folgt erst im nächsten Schritt.
–
Phase 2: Granulation (Neubildungs- bzw. Proliferationsphase)
Die Wunde ist vorbereitet; jetzt füllt der Körper den Defekt. Granulationsgewebe entsteht – ein rötlich-feuchtes, leicht „körniges“ Gewebe mit dichter Kapillarbildung. Kollagen- und Bindegewebszellen geben Halt, die Wundränder wandern zur Mitte. Schmerzen lassen meist nach; ein sanftes Spannen oder Pulsieren zeigt die aktive Durchblutung.
Gut für die Granulation:
-
Feuchtes Milieu stabil halten: hydroaktive Pflaster/Verbände, die Feuchtigkeit regulieren und atraumatisch zu entfernen sind.
-
Wechselrhythmus nach Bedarf: durchnässte, verrutschte oder riechende Auflagen rechtzeitig wechseln. Beim Abnehmen verklebte Stellen mit NaCl befeuchten statt „abreißen“.
-
Reibung & Druck reduzieren: Kleidung, Schuhwerk, Sitz-/Liegeposition anpassen; bei venösen Ulcera ärztlich verordnete Kompression konsequent tragen.
-
Ursachen adressieren: Blutzucker stabilisieren, Rauchstopp, Druckentlastung (Dekubitus), Durchblutung fördern (ärztliche Maßnahmen, Bewegung im Rahmen der Freigabe).
Wann zur Kontrolle? Wenn die Wunde „steht“, der Grund grau-gelblich bleibt, schlechter riecht, stärker schmerzt oder die Rötung am Rand zunimmt – das können Störzeichen (Beläge, Infektion, zu viel Druck) sein.
–
Phase 3: Epithelisierung (Regeneration und Remodelling)
Jetzt schließt die Haut. Vom Rand wandern Epithelzellen auf das Granulationsgewebe, Kollagen ordnet und vernetzt sich, das Gewebe wird fester. Ein vorhandener Schorf löst sich, darunter zeigt sich zarte rosige Haut. Häufiges Zeichen: Juckreiz – bitte nicht kratzen, um Mikroverletzungen zu vermeiden.
Narben verstehen: Narben sind anfangs rötlich und etwas wulstig, werden mit der Zeit blasser. Narbengewebe unterscheidet sich von normaler Haut (keine Haare, keine Schweißdrüsen, weniger Pigment). Sonnenschutz (SPF) und sanfte Narbenpflege (z. B. Massage nach Freigabe) fördern ein ruhiges Erscheinungsbild.
–
Häufige Fehler – und bessere Alternativen
-
„An der Luft heilen“: Trockene Kruste behindert Zellwanderung und reißt leicht ein.
Besser: feuchtes Wundmilieu mit geeigneter, atmungsaktiver Auflage. -
Unzureichende Reinigung: Zurückbleibende Partikel/Keime begünstigen Infektionen.
Besser: kurz, sanft spülen; bei Risiko einmalige Antiseptik. -
Am Schorf pulen: Reißt frisches Gewebe auf, öffnet Keimen Tür und Tor.
Besser: in Ruhe lassen; bei Bedarf befeuchten und atraumatisch lösen. -
Verklebende Verbände: Beim Wechsel „reißen“ neue Zellen mit ab.
Besser: atraumatische Materialien, die nicht an der Wunde haften. -
Überlastung/Reibung: Mechanischer Stress bremst Heilung.
Besser: Schutzpolster, Hochlagerung, passende Kleidung/Schuhe. -
Lebensstilbremsen: Rauchen verengt Gefäße; Mangelernährung liefert zu wenig „Baustoffe“.
Besser: rauchfrei, eiweißreich, vitamin- & zinkreich, ausreichend trinken.
–
Schritt-für-Schritt: So unterstützen Sie die Heilung gezielt
1) Reinigen
-
Hände waschen/desinfizieren.
-
Wunde mit lauwarmem Wasser/NaCl spülen; lose Partikel vorsichtig entfernen.
-
Antiseptikum sparsam & gezielt bei erhöhter Infektionsgefahr.
2) Schützen
-
Geeignete Auflage wählen: Hydrogel/Hydrokolloid oder nicht-haftende, saugfähige Verbände – je nach Wundtyp.
-
Auflage regelmäßig prüfen und nach Bedarf wechseln.
-
Reibung vermeiden, ggf. polstern oder fixieren.
3) Fördern
-
Dünn Wundpflege am Rand (z. B. Dexpanthenol-/Zinkanteile nach Empfehlung); bei trockener Oberfläche feuchtigkeitsregulierende Produkte.
-
Warm halten (ohne Wärmestau); maßvoll bewegen zur Durchblutungsförderung; keine Überlastung.
Heilen von innen – Ernährung & Flüssigkeit
Bei Gewebsreparatur steigt der Bedarf an Eiweiß – Baustoff für Zellen und Kollagen. Planen Sie pro Mahlzeit eine Eiweißquelle (Joghurt/Topfen, Eier, Hülsenfrüchte, Fisch/Geflügel, Tofu).
-
Arginin & Glutamin (in eiweißreicher Kost) unterstützen Mikrozirkulation, Kollageneinbau und Immunzellen.
-
Vitamin C fördert die Kollagensynthese (z. B. Paprika, Beeren, Zitrus), Zink/Selen die Zellteilung und Abwehr.
-
Trinken: Wasser/ungesüßte Tees über den Tag. Ohne Flüssigkeit stockt der Nährstofftransport.
Nahrungsergänzungen können Lücken schließen, ersetzen aber keine ausgewogene Ernährung. Bitte ärztlich/pharmazeutisch beraten lassen – besonders bei Vorerkrankungen oder Medikamenten.
–
Akute Wunden zu Hause versorgen – ein praxisnahes Beispiel
Situation: Ihr Kind kommt mit einer Schürfwunde am Knie vom Spielplatz.
Vorgehen:
-
Hände reinigen.
-
Wunde unter fließendem Wasser spülen, kleine Steinchen mit steriler Pinzette lösen.
-
Einmalig Antiseptikum, wenn viel Schmutz im Spiel war.
-
Hydroaktives Pflaster aufbringen (feuchtes Milieu, kein Verkleben mit Kruste).
-
Wechsel, wenn das Pflaster durchnässt/verrutscht.
-
In den ersten Tagen Reibung vermeiden, Hose nicht scheuern lassen, ggf. Polster.
-
Tetanusimpfschutz prüfen (bei tieferen/verschmutzten Wunden).
Erwartung: Nach wenigen Tagen beruhigt sich die Wunde, die Oberfläche wirkt rosig-ruhig; Juckreiz kündigt die Epithelisierung an.
–
Warum Wunden „stecken bleiben“ – typische Bremsklötze
-
Durchblutungsprobleme: venös (Stauung, Ödeme), arteriell (Minderdurchblutung) → Gewebe bekommt zu wenig Sauerstoff/Nährstoffe.
-
Druck & Scherkräfte: langes Sitzen/Liegen, schlecht sitzende Schuhe/Prothesen → Mikroverletzungen, Dekubitusrisiko.
-
Diabetes mellitus: langsamere Zellregeneration, Infektneigung, Sensibilitätsstörung im Fuß.
-
Infektionen/Biofilm: Keime bilden Beläge, die Granulation hemmen.
-
Mangelernährung/Flüssigkeitsdefizit: zu wenig Eiweiß, Vitamin C, Zink; zu wenig Trinken.
-
Rauchen: Gefäßengstellung, schlechtere Kapillardurchblutung.
-
Unpassende Produkte: Verklebende Auflagen, zu seltene/zu häufige Wechsel, aggressive Antiseptika.
Was tun? Ursachen aktiv angehen (z. B. Kompression bei venöser Insuffizienz, Druckentlastung bei Dekubitus, Blutzuckerkontrolle, Rauchstopp, Ernährungsaufbau) – und die lokale Versorgung phasengerecht ausrichten.
–
Feuchte Wundbehandlung – warum sie oft schneller ist
In einem feuchten Wundmilieu können Zellen besser wandern und sich teilen; Wachstumsfaktoren bleiben länger wirksam; die Krustenbildung wird reduziert – dadurch sinkt das Risiko, dass die fragile Oberfläche beim Verbandwechsel aufreißt. Moderne hydroaktive Auflagen (z. B. Hydrogel, Hydrokolloid, Schaum mit Sanftkleber) regulieren Feuchtigkeit, nehmen Exsudat auf, halten die Umgebung warm und schützen vor Reibung. Wichtig ist die passende Auswahl je nach Wundtiefe, Exsudatmenge und Phase – und ein Wechselintervall, das Feuchte-Balance und Hygiene vereint.
–
Alltag & Pflege – kleine Maßnahmen mit großer Wirkung
-
Kleidung/Schuhe: Reibungsarme Stoffe, weiche Nähte; Schuhe mit genügend Platz.
-
Schlafposition: Bei Beinwunden nachts leicht hochlagern; bei Druckgefährdung regelmäßig Lage ändern.
-
Duschen statt Baden: Kurz duschen ist oft möglich; danach trocken tupfen und neu versorgen. Baden erst, wenn die Wunde stabil ist.
-
Bewegung maßvoll: Fördert Durchblutung; vermeidet aber Stoß- und Verdrehbelastungen direkt am Wundareal.
-
Schmerzmanagement: Schmerz akzeptieren, aber nicht „ertragen“ – er führt zu Schonhaltungen und Reibung. Mit dem Behandlungsteam einfache Strategien besprechen.
-
Dokumentation: Foto/Notiz in größeren Abständen hilft, Fortschritte zu sehen – motivierend und nützlich bei Rückfragen.
–
Warnzeichen – wann zur Ärztin/zum Arzt?
-
Zunehmende Rötung/Wärme/Schmerz, Eiter, übel riechendes Sekret, Fieber/Schüttelfrost.
-
Tiefe, große oder klaffende Wunden, starke Blutung, Wunden im Gesicht/Gelenk/Genitalbereich.
-
Keine Besserung nach wenigen Tagen trotz korrekter Pflege – oder Verschlechterung.
-
Risikokonstellationen: Diabetes, Durchblutungsstörung, Blutverdünner, geschwächtes Immunsystem.
-
Bisswunden (Mensch/Tier), stark verschmutzte Wunden (Erde/Glas).
-
Tetanusstatus unklar – Auffrischung erwägen, wenn der letzte Schutz >10 Jahre zurückliegt (bei bestimmten Wunden früher).
–
FAQ – kurz & klar
Wie lange abdecken?
Bis die Wunde ruhig ist und nicht mehr nässt/reibt. Feuchte Wundversorgung ist oft schneller und angenehmer als „Lufttrocknen“.
Darf ich Sport treiben?
Kurz pausieren. Wieder einsteigen, wenn schmerzarm, gut geschützt und ohne Reibung/Druck möglich – lieber Meilensteine (Belastbarkeit) als fixe Tage.
Muss eine Wunde immer desinfiziert werden?
Nein. Sanftes Spülen reicht bei sauberen Akutwunden oft aus. Antiseptik gezielt bei Risiko (stark verschmutzt, Biss, Stich).
Was esst und trinkt man „richtig“?
Jede Mahlzeit mit Eiweißquelle, dazu buntes Gemüse/Obst (Vitamin C), Vollkorn; ausreichend Wasser/Tee. Ergänzungen nur nach Beratung.
Quellen
- Deutsche Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung (DGfW) – Patienteninformationen/Empfehlungen
- AWMF S3-Leitlinie „Lokaltherapie chronischer Wunden“
- NHS/NICE – Patienteninformationen zu Wundversorgung & Verbänden
- Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) / ESPEN – Ernährung in Heilphasen
Hinweis: Dieser Beitrag dient der Gesundheitsinformation und ersetzt keine medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung. Bei Warnzeichen bitte zeitnah ärztlich abklären.