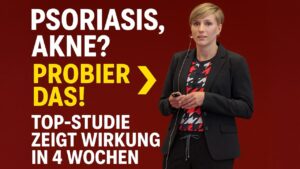KURZÜBERSICHT
Kurz erklärt
Frühe Rötung, die auf Druck nicht abblasst, ist das Startsignal. Ohne Entlastung droht ein tiefer Gewebeschaden.
Das hilft sofort
Druck reduzieren, Reibung vermeiden, Haut sauber & trocken halten, ausreichend essen & trinken – und Warnzeichen ernst nehmen.
Ärztlich abklären
Zunehmende Schmerzen, Wärme, Geruch/Eiter, Fieber oder sichtbare Tiefe → bitte zeitnah medizinisch beurteilen lassen.
Was ist ein Dekubitus?

Ein Dekubitus (Druckgeschwür) entsteht, wenn Haut und Unterhaut durch anhaltenden Druck oder Scherkräfte nicht mehr ausreichend durchblutet werden. Besonders bei Bettlägerigkeit oder sehr eingeschränkter Mobilität kann sich aus einer zunächst harmlosen Rötung eine tiefe, schmerzhafte Wunde entwickeln. Dieser Ratgeber erklärt die Stadien, häufige Ursachen, Warnzeichen und konkrete Alltagsschritte – damit Sie Risiken früh erkennen und gemeinsam mit dem Behandlungsteam gezielt vorbeugen.
–
Was genau passiert bei einem Dekubitus?
Anhaltender Druck (z. B. am Kreuzbein, an den Fersen) klemmt feinste Blutgefäße ab. Zellen erhalten zu wenig Sauerstoff und Nährstoffe; Gewebe wird geschädigt. Scherkräfte – etwa beim Hochziehen im Bett – verstärken das Problem, weil sich Hautschichten gegeneinander verschieben. International anerkannte Leitlinien beschreiben vier Stadien: von nicht wegdrückbarer Rötung (Stadium 1) über Blasen/Teilhautverlust (Stadium 2), bis zu tiefem Geschwür mit Subkutangewebe (Stadium 3) und freiliegenden Strukturen wie Muskel oder Knochen (Stadium 4). Unklassifizierbare und Sonderformen kommen vor.
–
Häufige Ursachen & Risikofaktoren
Die Entstehung ist meist multifaktoriell. Extern wirken Druck, Reibung, Scherkräfte und Feuchtigkeit (z. B. Schwitzen, Inkontinenz). Intern begünstigen eingeschränkte Beweglichkeit, Mangelernährung, Anämie und Begleiterkrankungen (z. B. Diabetes, Gefäßleiden) den Schaden. Auch sehr trockene oder aufgeweichte Haut, Polypharmazie und höheres Alter erhöhen das Risiko.
–
Stadien & Symptome – woran Sie es erkennen
-
Stadium 1: Umgrenzte Rötung, die bei Fingerdruck nicht abblasst; Haut warm, empfindlich, ggf. verhärtet.
-
Stadium 2: Teilverlust der Haut (Ober-/Lederhaut), flaches offenes Ulkus oder Blase; oft nässend und infektionsanfällig.
-
Stadium 3: Verlust aller Hautschichten, Schädigung/Nekrose des Unterhautfettes; tiefer Defekt, der bis zum Muskel reichen kann.
-
Stadium 4: Ausgedehnter Gewebsverlust bis auf Muskel, Sehnen, Knochen; hohes Infektions- und Sepsisrisiko.
Erste Anzeichen sind Verfärbung, lokale Wärme, Druckschmerz oder Taubheit – besonders über Knochenvorsprüngen (z. B. Kreuzbein, Fersen).
–
Sofortmaßnahmen im Alltag – ergänzend zur Pflege
Druckentlastung: Positionen regelmäßig wechseln, Kissen/Matratzen zur Druckverteilung nutzen, Scherkräfte beim Umlagern vermeiden (Gleit- oder Hebehilfen). Hautmanagement: Sauber, trocken, aber nicht ausgetrocknet; Inkontinenz gut versorgen. Bewegung fördern: Jede sichere Mobilisation zählt – auch kurze Sitz- und Stehphasen. Kontrolle:Täglicher Hautcheck an gefährdeten Stellen; Veränderungen dokumentieren (Foto/Notiz). Strukturiertes Repositionieren und geeignete Sitz-/Lagerungstechniken senken das Risiko nachweislich.
–
Behandlung – Bausteine des professionellen Vorgehens
Die Therapie richtet sich nach Stadium, Lokalisation, Schmerzen, Infektionszeichen und den individuellen Ressourcen. Typisch sind: Druckentlastung (oberstes Prinzip), sanfte Wundreinigung, bedarfsweise Debridement, sowie eine moderne Verbandstechnik für ein feucht-warmes Wundmilieu. Infektionen werden – falls nötig – nach Keimnachweis behandelt. Parallel: Optimierung von Blutzucker, Kreislauf und Schmerztherapie; Hilfsmittel und Pflegeroutinen werden angepasst. Die konkrete Auswahl trifft das Behandlungsteam nach Leitlinie.
–
Ernährung & Trinken: heilen von innen
Wundheilung ist Schwerstarbeit: Energie, Eiweiß und Mikronährstoffe müssen verfügbar sein. Empfohlen wird eine eiweißbetonte, ausgewogene Ernährung (nach individueller Verträglichkeit), ggf. ergänzende hochkalorische/hochproteinhaltige Trinknahrung – besonders bei Mangelernährung. Für ausgewählte Situationen werden Formeln mit Arginin, Zink und Vitamin C diskutiert; was passt, entscheidet das Behandlungsteam. Und: ausreichend trinken unterstützt Durchblutung und Nährstofftransport.
–
Typische Alltagshürden – und wie Sie sie umschiffen
Enge Kleidung oder Falten im Laken erzeugen punktuellen Druck. Achten Sie auf glatte Unterlagen, weiche, nahtarme Textilien und gut sitzende Schuhe/Prothesen. Bei Inkontinenz helfen saugfähige, atmungsaktive Materialien und ein klarer Pflegeplan. Nutzen Sie Erinnerungen (Wecker, Pflegetafel) für Lagerwechsel, Trinken und kleine Aktivitätspausen. Angehörige und Pflegekräfte sind wertvolle Partner – gemeinsam bleibt der Alltag machbar.
–
FAQ – kurz & klar
Muss die Wunde „an die Luft“?
Meist nicht. Ein geschütztes, feuchtes Wundmilieu unterstützt Zellwanderung und ist oft angenehmer – die Art des Verbandes legt das Team fest.
Wie oft umlagern?
Das Intervall ist individuell (Hautzustand, Matratze, Sitz-/Liegezeit). Wichtig ist konsequent zu wechseln und Scherkräfte zu vermeiden – Ihr Team legt den Plan fest.
Welche Warnzeichen deuten auf Infektion?
Zunehmende Rötung/Wärme, übler Geruch, Eiter, starke Schmerzen oder Fieber – bitte zeitnah abklären.
Quellen
- EPUAP/NPIAP/PPPIA: Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries – International Guideline, 2019
- NPIAP/EPUAP – Revidiertes Staging-System für Druckverletzungen
- NHS/NHS Inform – Patienteninformationen zu Druckgeschwüren
- Cochrane/Reviews zur Umlagerung & Scherkräfte (Repositioning)
- ESPEN/ASWC & Reviews: Ernährung bei Druckverletzungen (Eiweiß, Arginin, Zink, Vitamin C)
Hinweis: Dieser Beitrag bietet Orientierung und ersetzt keine medizinische Untersuchung, Diagnose oder Behandlung. Bitte holen Sie bei Warnzeichen zeitnah ärztlichen Rat ein.